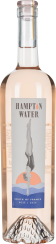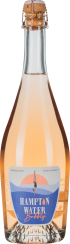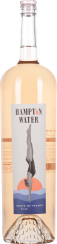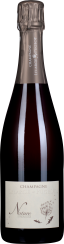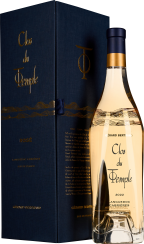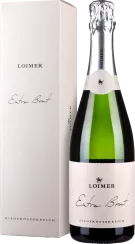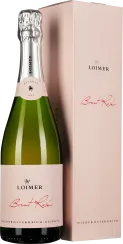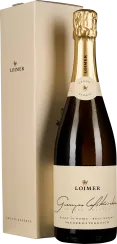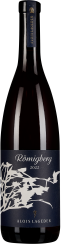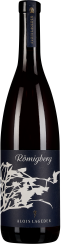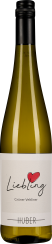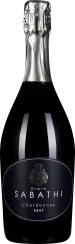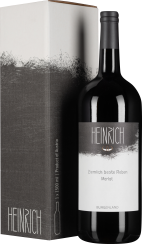Tiere machen die besseren Weine
Die nützlichsten Tiere im Weingarten

Autor: Gerhard Scholz
Wenn von Tieren im Weingarten die Rede ist, geht es oft um Schädlinge und darum, wie man sie möglichst effektiv vernichtet: Nach Kartoffeln ist Wein das Anbauprodukt mit dem höchsten Pestizideinsatz pro Hektar. Studien zufolge wird für jede Flasche Wein, die in Europa produziert wird, bis zu ein Teelöffel Pestizid versprüht, wodurch die Biodiversität im konventionell bewirtschafteten Weingarten auf die Hälfte reduziert wird.
Dabei ist es oft gar nicht notwendig, so schwere Geschütze aufzufahren, um der unerwünschten Besucher im Weingarten Herr zu werden. Für viele Winzer:innen besteht die Lösung nämlich nicht darin, die Artenvielfalt zu reduzieren, wie es Ende des 20. Jahrhunderts zur allgemeinen Praxis wurde, sondern diese im Gegenteil bewusst zu maximieren. Zahlreiche Blatt-, Blüten- und Traubenvernichter haben nämlich natürliche Fressfeinde, die man je nach Größe und Verbreitung mit geeigneter Begrünung anlocken oder mit dem Tiertransporter abladen kann. Um das Image der gefiederten, behaarten und manchmal auch ganz schön schleimigen Helfer im Weingarten aufzubessern, haben wir die wichtigsten in Gruppen eingeteilt und nach persönlicher Vorliebe einem Ranking unterzogen.
Vorhang auf für die Top 5 der Tiere, die nützlich, wenn nicht sogar essenziell für den Weinbau sind!
Empfehlungen
Platz 5 – Pferde, Esel und Maultiere
Eines der größten Probleme beim biologischen Weinbau ist die Bodenverdichtung. Wer nicht mit chemischen Spritzmitteln arbeitet, muss öfter durchs Feld fahren. Während viele Mittel der konventionellen Landwirtschaft in die Pflanzen eindringen und nicht vom Regen abgewaschen werden, müssen Tees und Kupferlösungen nach jedem großen Regenfall erneut ausgebracht werden. Die schweren Maschinen drücken die Erde im Weingarten bei jeder Fahrt zusammen und beeinträchtigen so nicht nur die Wasser- und Sauerstoffversorgung, sondern auch die Arbeit der Mikroorganismen bei der Humuserzeugung – exakt das Gegenteil von dem, was Bio-Bäuer:innen eigentlich bezwecken!
Bühne frei für Platz 5 unserer Top-Liste der Weingartenbewohner: Pferde, Esel und Maultiere.

Vorreiter ist hier Frankreich. Wer an den pittoresken Hügeln von Burgund entlang fährt, wo die wertvollsten Weine der Welt entstehen, stellt erstaunt fest, mit welchem Maß an Hand- und Hufarbeit hier die Weingärten bewirtschaftet werden. Ähnlich wie Österreich beim Weinskandal von 1985, erlebte Burgund seinen Weckruf zu Beginn der 1990er Jahre, als der einflussreiche Bodenforscher Claude Bourguignon vom französischen Institut für Agronomieforschung proklamierte, die Böden der renommierten Weinregion wiesen weniger Leben auf als der Sand der Sahara. Für unzählige Weingüter, darunter auch Stars wie Romanée-Conti, war die Studie der Anstoß, in Richtung Bioweinbau umzuschwenken und wieder Leben in die Weingärten zu bringen. Heute braucht man längst keinen Fototermin mehr, um tierisches Personal bei der Arbeit im Weingärten beobachten zu können, sodass das Pferd zwischen den Rebzeilen längst symbolhaft für die Region geworden ist.
Ähnliches gilt für die Region Languedoc, in der der größte biodynamische Weinproduzent der Welt, Gérard Bertrand, seine Reben bewirtschaftet. In seinen besten Weingärten kommen statt Traktoren ausschließlich Pferde und Maultiere zum Einsatz. So entstehen ganz ohne Bodenverdichtung – und nebenbei auch mit wesentlich weniger CO₂-Ausstoß – naturnahe Weine mit sensationeller Aromenfülle, die ihr volles Potenzial oft erst Jahre nach der Abfüllung entfalten. Die starken Winde und das warme Klima im Süden Frankreichs begünstigen den Bioanbau und machen dieses Vorgehen erst möglich.
Fast unmöglich gilt für viele die biodynamische Praxis in der kühlen und regnerischen Champagne – nicht so jedoch für Dominique Lelarge vom Weingut Lelarge-Pugeot. Seit 2000 verzichtet er völlig auf Insektizide, um mehr Leben in die Böden zu bringen. Im nächsten Schritt reduzierte den Einsatz von Fungiziden und Herbiziden und ehe er sich versah, war er Biodynamiker, sodass er seine vielschichtigen Champagner heute mit Demeter-Siegel auf den Markt bringt. Zu größerer Biodiversität verhelfen seinen Weingärten nicht nur Bienenstöcke und Obstbäume, sondern auch die Pferde, mit denen er die Erde pflügt.
Platz 4 – Hühner und Gänse

Hühner und Gänse vertilgen Unkraut, helfen bei der Laubarbeit, fressen zum Teil sogar Schädlinge und sorgen für natürlichen Dünger. Erwünschter Nebeneffekt sind Eier und – je nach Philosophie – auch Gänsebraten. Wobei Marco Salvadori von der Casa Emma die Idee schockiert von sich weist: Die 80 Gänse, die ihn bei der Bodenbewirtschaftung unterstützen, würde er nie im Leben schlachten. Neben der persönlichen Beziehung zu den Tieren, ist ihm auch der Qualitätsboost zu wertvoll, für den sie in den Weinen sorgen.
Aber nicht nur in Italien gibt es geflügelte Weingartenhelfer. In Österreich gehört auch Fred Loimer zu den bekennenden Hühnerhaltern. Für ihn ist eine gesunde Flora und Fauna essenziell für einen gesunden Weingarten. Im Weingarten von Pferden, Schafen und eben auch Hühnern umgeben zu sein, gibt ihm das Gefühl, richtig zu handeln, und für ihn ist der Einklang mit der Natur und dem Kosmos das Um und Auf. Wenn man ihn mit seinen Tieren sieht oder seine grandiosen Weine probiert, muss man ihm in diesem Punkt unweigerlich recht geben.
Ebenso lässt sich auch Hannes Harkamp im Weingarten von Schafen und Hühnern helfen. Wie Loimer setzt auch er neben Stillweinen auf die Produktion präziser Schaumweine, die zu den besten des Landes gehören. Nicht nur, weil frische Eier und Sektfrühstück einfach zu gut zusammenpassen.
Platz 3 – Rinder
Schnitt in die norditalienische Region Trentino-Südtirol. Die Alpen und die Dolomiten bestimmen hier das Landschaftsbild und dazu gehört unweigerlich das Gebimmel von Kuhglocken. Die ländlich-romantische Geräuschkulisse ist aber nicht der eigentliche Grund für die besten Weingüter der Region, auf eigene Rinder zu setzen. Für den Dünger, den die Ochsen und Kühe produzieren, müsste sich das Geflügel anderer Weingüter nämlich mächtig ins Zeug legen.
Familie Lageder ist besonders die Rinderhaltung ein Anliegen. Während die männlichen Jungrinder, die für die Milchwirtschaft keinen Nutzen haben, anderswo an Mastbetriebe verkauft oder zu Kalbfleisch verarbeitet werden, dürfen sie bei Lageder das ganze Jahr über im Freien hausen. Die Sommer verbringen sie auf der Alm, das restliche Jahr über wohnen sie am Weinberg. Erst nach drei oder vier Jahren werden sie auf der Weide möglichst angst- und stressfrei geschlachtet und von den hauseigenen Köch:innen im Ganzen verwertet. Im Norden Italiens bildet diese Förderung der Biodiversität, die außerdem Schweine, Hühner, Gänse, Truthähne, Pfaue und eigene Gemüsegärten umfasst, einen wichtigen Gegenpol zur vorherrschenden Wein-und-Apfel-Monokultur.

Emilio, Theo und Myrtha vom Weingut Foradori haben zwar nur halb so viel Rebfläche wie Lageder, dürfen aber auch immerhin sechs Tiroler Graukühe ihr Eigen nennen, die nicht nur Dünger, sondern auch Milch produzieren. Auch hier wird ein Garten mit 30 biodynamischen Gemüsesorten gepflegt.
Das Ideal der Kreislaufwirtschaft sieht vor, dass alles, was auf dem Weingut zum Einsatz kommt, auch am Weingut produziert wird. Da aber die ganzjährige Rinderhaltung nicht überall im gleichen Maß funktioniert, kann man, wenn man auf Kunstdünger verzichten will, entweder den Mist von Rindern, Schafen, Pferden und Wasserbüffeln von zertifizierten Partnern einkaufen oder man beherbergt wie das neuseeländische Spitzenweingut Dog Point Gast-Tiere: 25 Jungstiere und 2.500 Schafe dürfen sich an den Gräsern und Kräutern zwischen den Reben sattfressen und sorgen für größere Bodenfruchtbarkeit.
Platz 2 – Schafe
Womit wir bei Platz 2 angelangt wären: Schafe. Nicht nur in Neuseeland gehören die vierbeinigen Pulloverträger zu den absoluten Stars im Weingarten. Im Traisental zum Beispiel erhöht Markus Huber die Artenvielfalt nicht nur durch das Pflanzen von Sträuchern, Bäumen und Hecken, sondern auch, indem er Schafe im Weingarten grasen lässt. Voraussetzung dafür ist natürlich die biologische Bewirtschaftung der Reben, denn mit chemischen Spritzmitteln sollten die Tiere besser nicht in Kontakt kommen.

Unser Weinschaf Marcello verlebendigt nicht nur unseren Markenauftritt, sondern Marcello und zahlreiche weitere Schafe mähen und mulchen sehr fleißig unsere Steilstlagen.
Ähnlich macht es auch Erwin Sabathi in der Südsteiermark. Er setzt auf das Krainer Steinschaf, eine alte, wetterharte Schafrasse, die traditionell als Milchschaf gehalten wurde. Die Schafe helfen sanft beim Mähen und Mulchen und verletzen dabei weder die Grasnarbe, noch verdichten sie den Boden.
Der burgenländische Paradebetrieb in puncto Nachhaltigkeit und Qualitätsweinbau, das Weingut Triebaumer in Rust, schwört dagegen auf das Ruster Weingartenschaf. Die Tiere leben das ganze Jahr über im Weingarten und erledigen das Mähen, Stämme putzen, das Düngen und sogar das Ausblättern. Wenn die Tiere ihre Wolle an den Weinbergpfählen abreiben, kann diese sogar abschreckend auf Schädlinge wirken.
Platz 1 – Spinnen, Insekten und Würmer
Darüber hinaus punktet Familie Triebaumer auch bei unserer ungeschlagenen Nummer Eins: den Insekten. Auch wenn die Weinrebe als Selbstbefruchter bei der Vermehrung nicht auf die Unterstützung von Insekten angewiesen ist, tragen diese enorm zur Biodiversität bei. Aktuell ist durch den großflächigen Einsatz landwirtschaftlicher Insektizide in Österreich mehr als die Hälfte der 700 heimischen Bienenarten vom Aussterben bedroht. Die Imkerei, wie sie in Rust betrieben wird, dient also nicht nur dem Erhalt eines stabilen Ökosystems, sondern auch dem Arten- und Umweltschutz. Nebenbei produzieren die fleißigen Insekten wohlschmeckenden Honig.
Auch wenn das komplexe ökologische System Weingarten wahrscheinlich nie ganz entschlüsselt werden kann, machen sich ökologisch vorgehende Winzer:innen wie Gernot Heinrich und Birgit Braunstein diese Effekte ganz einfach zunutze, indem sie Sträucher, Hecken und Obstbäume setzen, um Lebensräume für Insekten, Spinnentiere und Vögel zu bieten, die das lebendige Ökosystem Weingarten auf natürliche Art und Weise in Balance halten. Selbstverständlich erreichen sie so nicht dieselbe Ausbeute wie industrielle Weinproduzent:innen, aber spätestens wenn man die Weine der genannten Weingüter kostet, erkennt man, dass von den mit Leben gefüllten Weingärten alle profitieren: die Tiere selbst und ihre Umwelt, die Winzer:innen und natürlich auch die Kund:innen, die nicht nur heute, sondern noch in Jahrzehnten erstklassige, natürlich hergestellte Weine trinken dürfen.

Während die „konventionelle“ Landwirtschaft Insekten primär als Schädlinge begreift, ist Biobäuer:innen bewusst, dass gesunde Böden ohne Insekten und Würmer undenkbar sind. Ihre offensichtlichste Aufgabe ist neben der unmittelbaren Bodenarbeit und der Verbreitung von Pflanzen die direkte Interaktion mit anderen Insektengattungen: Marienkäfer ernähren sich von Spinnmilben. Schweb- und Florfliegen sind regelrechte Blattlausvernichter. Zwerg- und Erzwespen kämpfen effektiv gegen Rebzikaden und Traubenwickler. Selbst die generell weniger beliebten Wanzen und Spinnen tragen unmittelbar zur Reduktion von Schädlingspopulationen bei. Aktuelle Forschungsprojekte legen aber nahe, dass die Beziehungen zwischen Insektenwelt und Schädlingsbekämpfung wesentlich komplexer und indirekter sind, als bisher nachgewiesen werden konnte. So reicht die Präsenz einer bestimmten Gattung manchmal aus, dass konkurrierende Gattungen ihr Fress- und Nistverhalten umstellen, was sich wiederum auf das Verhalten anderer Arten auswirkt.
Alle Weine
der tierischen Helferlein