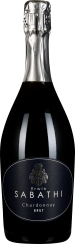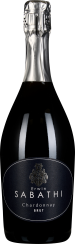Sortiment
Erwin Sabathi
Das Fundament für großartige Weine bildet großartiges Terroir – und genau dieses steht Patrizia und Erwin Sabathi im südsteirischen Leutschach reichlich zur Verfügung. Gemeinsam führt das Winzerpaar das Weingut Sabathi in zehnter Generation mit großem Erfolg. Einen hervorragenden Ruf hatte sich Erwin Sabathi mit seinen Weinen bereits ab 1992 erarbeitet, doch mit dem Einstieg seiner Frau Patrizia kam weiterer Schwung in das Qualitätsstreben. Seit einigen Jahren ist der Betrieb organisch-biologisch zertifiziert. Weiterhin sind zu 100 Prozent traditionelle Handlese und spontane Vergärung wesentliche Aspekte in der Herangehensweise, welche das Ziel hat, die Herkunft und den Charakter einzelner Rieden bestmöglich in die Flasche zu transportieren.
Angesichts der bis 1650 zurückreichenden Weinbautradition haben sich Patrizia und Erwin Sabathi zuletzt intensiv mit Heraldik beschäftigt, was zur Kreation und Stiftung eines Wappens führte. Als Symbol für den Betrieb ziert es nun die Etiketten der Weine.

375 Jahre Weinbautradition
Seit 10 Generationen und exakt 375 Jahren betreibt Erwin Sabathis Familie Weinbau. Schon um 1500 waren die Vorfahren von Erwin Sabathi aus der Umgebung von Rom hinauf in die Südsteiermark gezogen und hatten sich bei Gamlitz niedergelassen, wo Erwins Ahne Jerg ab 1650 einen Weinbaubetrieb mit gemischter Landwirtschaft führte. Inzwischen liegt der Stammsitz von Patrizia und Erwin seit über 80 Jahren in Leutschach und die Weine strahlen prächtiger denn je. Der Pössnitzberg ist mit seinem charakteristischen Terroir untrennbar mit dem Namen Erwin Sabathi verbunden und bringt Weine hervor, die regelmäßig mit Bestnoten überschüttet werden.
Zur Feier des 375-jährigen Bestehens seiner Weinbaudynastie hat Erwin Sabathi zwei Jubiläumsweine kreiert – einen Chardonnay und einen Sauvignon Blanc, die beide aus dem exzellenten Jahrgang 2023 stammen und deutlich die Pössnitzberg-DNA in sich tragen.
Wir haben beide Jubiläumsweine verkostet und finden sie qualitativ überragend: sehr ausbalanciert mit zugänglicher Frucht, messerscharfem Fokus und Präzision. Mit großem Potenzial, aber nicht nur für Sammler:innen. Frisch, saftig und gut strukturiert. Tiefgründig und mineralisch. Die Essenz des Pössnitzbergs.
Patrizia und Erwin Sabathi feiern Jubiläum

Wo der Prössnitzberg im Glas glänzt
Präzise und ausdrucksstark spiegeln die Weine von Patrizia und Erwin Sabathi das großartige Terroir von Leutschach in der Südsteiermark wider. Die kühlen klimatischen Einflüsse und die gebietstypischen Opokböden werden schon in den Ortsweinen durch animierende Frische und feine Mineralität am Gaumen spürbar. Sowohl der Sauvignon Blanc Leutschach als auch der Chardonnay Leutschach vereinen hohes Niveau mit viel Trinkfluss. An der Spitze der Qualitätspyramide zeichnen die Riedenweine der Sabathis enorme Komplexität, Intensität und Finesse aus. Der Chardonnay Ried Schlossberg Graf 2022 ist geprägt von Struktur und Eleganz, noch mehr Lagerpotenzial verspricht der wunderbar vielschichtige Chardonnay Ried Pössnitzberg 2021, der zwei Jahre im kleinen Eichenholzfass ruhte. Die extrem steile und von dichten Wäldern umgebene Lage Pössnitzberg bildet nicht nur das Herzstück des Weinguts, sondern ist auch die südlichste Riede der Steiermark. Seit langer Zeit ist das Weingut Erwin Sabathi organisch-biologisch zertifiziert, alle Trauben werden von Hand gelesen und die Weine werden spontan vergoren.
So gelangen die Herkunft und der Charakter einzelner Rieden bestmöglich in die Flasche. Direkt zwischen den großartigen Weingärten am Pössnitzberg entspringt der glasklare Pössnitz-Bach. Unter anderem zeugen Edelkrebse hier von hoher und sauberer Wasserqualität. Natur-, Umwelt- und Tierschutz haben für Patrizia und Erwin Sabathi einen sehr hohen Stellenwert. Für ihr unermüdliches Qualitätsstreben werden sie regelmäßig mit Auszeichnungen und Preisen belohnt. So erhielt ihre aktuelle Weinserie wieder herausragende Bewertungen von Falstaff. Sage und schreibe 99 Punkte gab es sowohl für den Chardonnay als auch für den Sauvignon Blanc von der Ried Pössnitzberger Kapelle vom Jahrgang 2021. Dazu regnete es für die Riedenweine mehrfach 97, 95 und 94 Punkte – ein beeindruckendes Ergebnis!
Patrizia & Erwin Sabathi im Interview

Liebe Patrizia, lieber Erwin, Winzerinnen und Winzer arbeiten in einer „Werkstatt unter freiem Himmel“ – auch in der Steiermark gab es heuer bereits einige Unwetter. Wie sehr wart ihr davon betroffen?
Patrizia Sabathi: Wir waren zum Glück von bisherigen Unwettern nicht wirklich betroffen, da wir unsere Weingärten mit Hagelnetzen schützen, eine Investition die sich dankenswerterweise sehr bezahlt macht. Denn Hagelnetze schützen einerseits vor Mengenverlust, andererseits vor Qualitätsverlust, da die Trauben unbeschädigt bleiben. Wir sind ganzjährig der Natur ausgesetzt, aufatmen und in Sicherheit wiegen können wir uns erst dann, wenn die gesamte Ernte wohl eingebracht ist.
Seit vielen Jahren bewirtschaftet ihr euer Weingut organisch-biologisch. Welche Veränderungen konntet ihr dadurch im Weingarten – und in den Weinen – beobachten?
Erwin Sabathi: Betreffend die Weingärten zeigt unsere Erfahrung klar und deutlich: Durch die biologische Bewirtschaftung haben wir Weingärten mit einer sehr hohen Biodiversität, woraus gesunde Böden mit gestärkten, sehr widerstandsfähigen Rebstöcken resultieren. Die an die Natur angelehnte Arbeitsweise drückt sich folglich auch in unseren Weinen aus. Werden keine chemisch-synthetisch hergestellten Pflanzenschutzpräparate und Düngemittel verwendet, verbleiben die Pflanzen in ihrem natürlichen Wachstums- und Reiferhythmus. Es gibt kein „Pflanzen-Tuning“. Wir erhalten kleine Beeren mit einer hohen Geschmackskonzentration und histaminarme Weine mit einer extrem langen Lagerfähigkeit.
Warum ist die Spontangärung so wichtig? Würdet ihr sagen, dass Weine, die mit Reinzuchthefe vergoren wurden, geschmacklich weniger komplex sind?
Patrizia: Bei uns erfolgt die Gärung ausnahmslos mit eigenen Weingartenhefen, um das Terroir unmittelbar zu transportieren. Wir verwenden keine Reinzuchthefen. Weine, die mit Reinzuchthefen vergären, sind tatsächlich geschmacklich weniger komplex und können die Herkunft nicht widerspiegeln. Wir erklären auch gern, warum: Geologie, Boden und Klima sorgen für eine eigenständige Mikroorganismen-Mischung. Unterschiedliche Herkünfte unterscheiden sich ganz klar anhand dieser Mikroorganismen-Stämme. Jeder Weingarten, jede Traube, jede Beerenschale besitzt eigene Hefestämme. Nur diese transportieren 1:1 die Herkunft. Sobald man mit Reinzuchthefen eingreift, handelt es sich um eine klare Manipulation, welche die Herkunft verschleiert. Der Geschmack wird vereinheitlicht. Und um mit den natürlichen Weingartenhefen arbeiten zu können, gibt es nur einen einzigen Weg: die biologische Bewirtschaftung. Wenn man die Weinwerdung begleitet, möglichst wenig Einfluss in natürliche Prozesse nimmt, dann enthält der Wein die größte nachvollziehbare Herkunft. Und genau darauf basiert unsere Philosophie: „Unsere Weine sind Ausdruck unseres Terroirs.“
Die steilen Rieden am Pössnitzberg bieten sowohl dem Sauvignon Blanc als auch dem Chardonnay ein großartiges Terroir. Was zeichnet den Pössnitzberg aus?
Erwin: Wir sind am Pössnitzberg fast alleinige Bewirtschafter und unsere dortigen Lagen haben Bodenverhältnisse, die in Österreich einzigartig sind. Sie gleichen jenen, die diese Weine auch in ihrer ursprünglichen Heimat so groß werden lassen: extrem karge, kalkhaltige Böden in Kombination mit weiteren besonderen Bodenstrukturen – wie in Burgund. Wir haben das Potenzial dieser Böden rechtzeitig erkannt und neben Sauvignon Blanc schon vor langer Zeit auch Chardonnay gepflanzt. Aber Weingärten mit grandiosen Bodenverhältnissen zu besitzen, reicht allein nicht aus. Eine ebenso wichtige Komponente ist die Art unserer Bewirtschaftung. Nicht der Pössnitzberg allein ist die Garantie für großartige Weine – das Terroir, aber auch die Menschen, die dahinterstehen, machen Weine vom Pössnitzberg zu „Pössnitzberg“.
Der weltweit verbreitete Chardonnay trägt in der Südsteiermark auch den Namen „Morillon“. Warum bevorzugt ihr für eure Weine die Bezeichnung „Chardonnay“?
Patrizia: Für die Sorte Chardonnay gab und gibt es sehr viele Synonyme – mit unterschiedlichen Entstehungsgeschichten, jedoch nicht immer mit eindeutigen Nachweisen. Vor mehreren hundert Jahren tauchte der Begriff „Morillon Blanc“ auf, dessen Entstehung aber nicht klar zuordenbar ist und in der Literatur ganz unterschiedlich begründet wird. Irgendwann reduzierte sich der Name auf „Morillon“, den man fast ausschließlich in der Steiermark kennt, international aber nie Anwendung fand. „Chardonnay“ ist hingegen der in Frankreich festgelegte, herkunftsabhängige Sortenname, die gängige und allseits bekannte internationale Bezeichnung. Deshalb verwenden wir ganz klar den Begriff „Chardonnay“, der sich auf jeder internationalen Weinkarte durchgesetzt hat. Jeder Kunde und jede Kundin, regional sowie international, weiß bei „Chardonnay“, worum es geht, bei „Morillon“ ist das nicht so.
In der Herkunftspyramide der Steiermark bilden die Ortsweine die mittlere Stufe zwischen den Gebiets- und den Riedenweinen. Wie hebt sich ein Ortswein aus Leutschach von anderen Ortsweinen ab?
Erwin: Leutschach ist der südlichste Weinbauort der Steiermark, aber nicht unbedingt der wärmste. Durch die geografischen und klimatischen Gegebenheiten spiegeln unsere Ortsweine kühle Frische wider und sind geschmacklich von unseren Kalkmergelböden geprägt. Wir meinen, dass Weine, die ihre Herkunft charakterisieren sollen, ein natürliches Gebinde benötigen, um möglichst ohne Einfluss des Menschen heranreifen zu können. All unsere Ortsweine reifen daher in traditionellen Holzfässern und unterstreichen unseren hohen Qualitätsanspruch.
Vielen Dank für das Gespräch!
Impressionen
Erwin Sabathi